Flutschäden an Trinkwasser- und Heizungs-installationen minimieren

Foto: SCHELL
GmbH & Co. KG
Der Starkregen
der letzten Wochen und die daraus entstehenden Fluten haben einige Gebiete in
Deutschland schwer getroffen – mit schlimmen Folgen für die dort lebenden
Menschen. Neben der Zerstörung von Gebäuden und Infrastruktur drohen jetzt noch
weitere gesundheitliche Risiken.
Es fehlt vielerorts nicht nur an Trinkwasser. Teilweise gelangte mit
Chemikalien und Abwässern belastetes Wasser in die Wassergewinnungsanlagen und konnte
so in teilweise- oder vollständig zerstörte Versorgungsleitungen und in die
Trinkwasser-Installation von Gebäuden eindringen. Doch selbst bei unzerstörten
Installationen in Gebäuden kann dies der Fall sein, beispielsweise über
Sicherungsarmaturen. Der VDS-Partner Schell zeigt auf, wie mit
Heizungs- und Trinkwasser-Installationen bei unzerstörter und wiedererrichteter
Infrastruktur umgegangen werden sollte. Der
Armaturenhersteller ist spezialisiert auf hygienische Lösungen im
Sanitärbereich.
Die Qualität des Trinkwassers, wie es die Wasserversorger
bereitstellen, entspricht grundsätzlich höchstem Niveau. Durch die Fluten sind
jetzt aber Verschmutzungen aus Kläranlagen, Fahrzeugen, Industriebetrieben usw.
in den Verantwortungsbereich des Wasserversorgers gelangt, und damit an die
Trinkwasser- und Heizungs-Installationen von Häusern. Daraus ergeben sich einige
Risiken: Das Trinkwasser hat nicht die gewohnte Qualität und darf nicht oder
nur eingeschränkt genutzt werden. Wasserberührte Oberflächen sind mit
Krankheitserregern und Chemikalien kontaminiert. Dazu gefährden Schlamm und
Chemikalien technische Bauteile und führen später zu Ausfällen von mechanischen
Sicherungseinrichtungen. Zudem können dauerhaft durchfeuchtete Dämmungen z. B.
von Rohrleitungen oder Armaturen zu Lochkorrosionsschäden führen.
Überprüfung der kompletten Heizungs- und Trinkwasserinstallation

Tabelle 1:
Mindestumfang von Spülmaßnahmen zur Reinigung von Trinkwasser-Installationen
gemäß DVGW W 557. Es müssen die Mindestanzahl an Armaturen gleichzeitig
geöffnet sein, um eine Spülleistung von 2m/Sek. zu erzielen.
Quelle: gemäß DVGW W 557
Die im Folgenden beschriebenen Spülungen und
Desinfektionsmaßnahmen in der Trinkwasser-Installation ergeben erst Sinn, wenn
das Trinkwasser vom Versorger wieder als Lebensmittel freigegeben ist. Denn ohne
diese Freigabe würde das nachströmende Wasser die Trinkwasser-Installation
erneut verunreinigen. Daher muss zunächst die komplette Heizungs- und
Trinkwasser-Installation überprüft werden, inwieweit sie mit dem Wasser der
Flut in Kontakt gekommen sind. Heizungsanlagen und Warmwasserbereiter werden
bei einem solchen Kontakt in aller Regel nicht repariert, sondern vollständig erneuert.
Jede beschädigte oder mit Wasser unklarer Beschaffenheit geflutete Installation
sollte nach einer fachgerechten Reparatur auf Dichtheit überprüft, gereinigt (Tabelle
1) und bei einer Trinkwasser-Installation auch erst anschließend desinfiziert
werden (Tabelle 2).
Wesentliche Hinweise zur
Vorgehensweise finden sich im DVGW-Arbeitsblatt W 557 „Reinigung und
Desinfektion von Trinkwasser-Installationen“ (Okt. 2012) sowie im
ZVSHK-Merkblatt „Dichtheitsprüfung von Trinkwasser-Installationen mit Druckluft, Inertgas oder Wasser“. Die in Tabelle
2 angegebenen Konzentrationen und Einwirkzeiten für die Anlagendesinfektion sollten
unbedingt eingehalten werden, um die volle Wirkung zu erzielen und gleichzeitig
Schäden an der Installation vorzubeugen.
Umgang mit offenen und halbfertigen Installationen
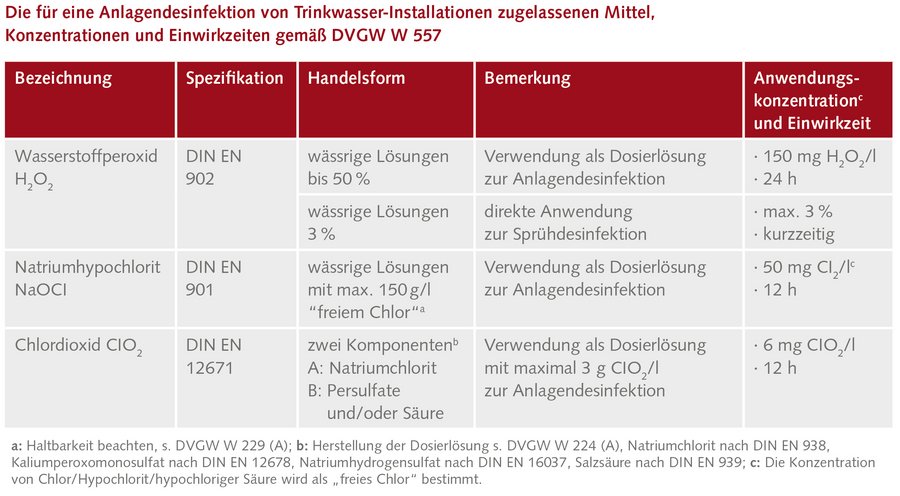
Tabelle 2: Die für eine Anlagendesinfektion von
Trinkwasser-Installationen zugelassenen Mittel, Konzentrationen und
Einwirkzeiten.
Quelle: gemäß DVGW W 557
„Halbfertige“ bzw. geborstene Trinkwasser-Installationen, die
beispielsweise in einem Roh- oder Neubau geflutet wurden, sind so zu verschließen,
dass sie umgehend entsprechend der Regelwerke von ZVSHK und DVGW mit einem
Wasser-Luft-Gemisch gespült und gereinigt werden können (Tabelle 1).
Möglicherweise müssen komplexe Installationen dafür in kleinere Einheiten
unterteilt werden. Befindet sich die Trinkwasser-Installation in einem Objekt
mit hohen hygienischen Anforderungen (z. B. Alten- und Pflegeheim,
Krankenhaus), empfiehlt sich eine Desinfektion und anschließende
mikrobiologische Freigabe-Untersuchung. Bei Heizungsrohren ist eine Desinfektion nicht notwendig, aber die
Bauteile müssen ebenfalls innen frei von Feststoffen sein, da es sonst zu
Störungen kommen kann.
Bei Trinkwasser-Installationen sollte immer eine mikrobiologische
Wasseruntersuchung durchgeführt werden (Tabelle 3). Diese Untersuchungen
liefern die notwendigen Informationen, wie erfolgreich die Reinigung und
Desinfektion aus hygienischer Sicht war. Damit sichern sie auch die Arbeiten des
Fachhandwerks ab. Dabei sollten mindestens die mikrobiologischen Parameter
„Allgemeine Bakterien“, „Coliforme Bakterien“ und „E. Coli“ gemäß Tabelle 3 untersucht
werden. Letztgenanntes Bakterium ist der Anzeiger einer fäkalen Verunreinigung.
Weitergehende Untersuchungen auf Legionellen sind nicht notwendig.
Untersuchungen auf Pseudomonaden nur bei besonderen Fragestellungen.
Umgang mit unbeschädigten Installationen
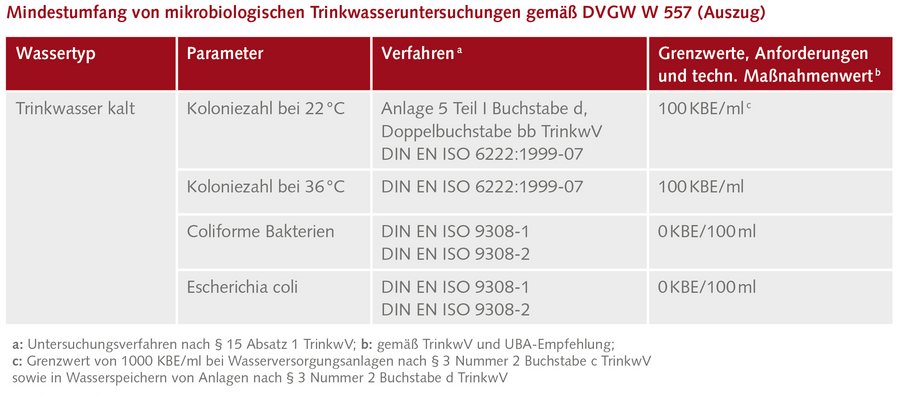
Tabelle 3:
Mindestumfang von mikrobiologischen Trinkwasseruntersuchungen gemäß DVGW W 557.
Weitere wertvolle Hinweise finden sich im DVGW W 556 „Hygienisch-mikrobielle
Auffälligkeiten in Trinkwasser-Installationen; Methodik und Maßnahmen zu deren
Behebung“
Quelle: DVGW W 557 (Auszug)
Noch
nicht wieder genutzte und intakte Trinkwasser-Installationen dürfen erst dann
wieder zur Abgabe von Trinkwasser als Lebensmittel genutzt werden, wenn das
Trinkwasser generell vom Versorger freigegeben wurde und eine Reinigung und
Spülung der Trinkwasser-Installation erfolgt ist. Vor der Spülung wird die
Anlage im ersten Schritt nach unten komplett entleert und sofort wieder mit
Trinkwasser gefüllt, um Korrosionsschäden durch eine Teilbefüllung zu vermeiden.
Durch diese Entleerung nach unten werden lokale Kontaminationen zum Beispiel aus
dem Kellerbereich nicht im gesamten Gebäude verteilt, die vielleicht über
Sicherungsarmaturen eingedrungen sind. Anschließend ist eine Dichtheitsprüfung
sinnvoll, wenn Beschädigungen an Rohrleitungen oder Armaturen vermutet werden, die
beispielsweise durch aufschwimmende Gegenstände während einer Flutung
entstanden sind. Eine längere Entleerung der Leitungen sollte generell vermieden
werden, damit es nicht nachfolgend zu Schäden durch Innenkorrosion kommen kann.
Umgang mit gefluteter Neuware
Normalerweise ist die Entsorgung von gefluteten Bauteilen die
sinnvollste Lösung, selbst wenn sie unbeschädigt erscheinen. Ist dies aus
Materialmangel nicht möglich, und sind die Bauteile erkennbar nass oder sogar
in Mitleidenschaft gezogen, empfiehlt sich eine Nachfrage beim Hersteller zur
weiteren Vorgehensweise. Kontaminiertes Schmutzwasser kann sogar in
Beutelverpackungen oder abgestopfte Rohre eingedrungen sein, ohne dass dies auf
den ersten Blick zu erkennen ist. Zwingt also Materialmangel zur Weiternutzung,
müssen bei Rohren, Verbindern und anderen Bauteilen die Stopfen/Verpackungen
entfernt, die Produkte mit einwandfreiem Trinkwasser durchgespült und dann
zügig getrocknet werden (Rohre mit Gefälle lagern). Wo immer dies notwendig und
möglich (Materialverträglichkeit) ist, sollten geflutete Bauteile für die
Trinkwasser-Installation wie Rohre und Verbinder ausschließlich für
Heizungs-Installationen verwendet werden.
Grundsätzlich dürfen bei
Reinigungsmaßnahmen keinerlei Ablagerungen in den Produkten verbleiben, da sie
unter anderem Wasser binden und Bakterien eine gute Vermehrungsmöglichkeit
bieten würden. Auch zur Desinfektion von einzelnen Bauteilen finden sich im
DVGW W 557 wertvolle Hinweise – z. B. im Kapitel „7.3 Desinfektion von
Apparaten und Bauteilen“. Werden solchermaßen gereinigte und desinfizierte Bauteile
in der Trinkwasser-Installation verwendet, müssen diese Trinkwasser-Installationen
nach dem Einbau erneut gründlich gespült (Tabelle 1) und im Zweifelsfall gemäß
Tabelle 2 desinfiziert werden. Eine mikrobiologische Kontrolluntersuchung ist
sinnvoll bzw. kann vom Gesundheitsamt angeordnet werden.
Fazit:
Ein Regelwerk für Fälle wie Überschwemmung, Hochwasser oder Flut gibt
es nicht. Doch insbesondere die DVGW Arbeitsblätter W 556 und W 557 geben eine
gute Orientierung, ersetzen jedoch nicht die übergeordneten Anweisungen der
lokalen Gesundheitsämter und Wasserversorger.



